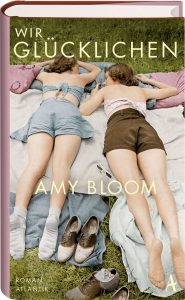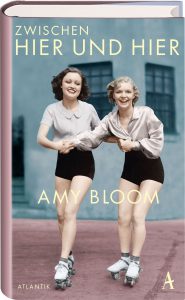Uns fehlt im Deutschen ein Wort für Schicksal. Was hat’se denn nun, werden Sie vielleicht denken. Da ist es doch: Schicksal. Gerade hingeschrieben, was war daran so schwer? Schicksalsschwer klafft genau hier die Lücke. Schicksal klingt nach Vorbestimmung, Schwere, Unausweichlichkeit. Was ist aber mit all den Dingen, die einfach so passieren, die einfach sind? Weder schwer schlimm noch grandios toll sind? Die sind ja auch in meinem Leben. Und natürlich
handele ich auch selbst und schaffe damit Schicksal für andere. Wenngleich sich das die meiste Zeit alles nicht schicksalsschwer anfühlt. Sondern normal, es ist wie es ist. Wie komme ich da jetzt drauf? Beim vor-mich-hin-Blättern in meinem E-Book-Ordner bin ich zufällig wieder bei Wir Glücklichen vorbei gekommen. Amy Bloom fängt ihren Roman grandios an: „Die Frau meines Vaters war gestorben.“*
Und zack war ich drin in einer Geschichte, die wie alle Geschichten im Leben natürlich schon viel früher angefangen hatte, jetzt aber beginnt sie so: „Die Frau meines Vaters war gestorben. Meine Mutter sagte, wir sollten hinfahren und sehen, ob es für uns etwas zu holen gebe.“ Eva, die zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt ist, erzählt so von dem Tag, an dem ihre alleinerziehende Mutter sie beim Vater absetzt. Das merkt die 12-Jährige erst ein bisschen später. Sie ist damit beschäftigt ihre Halbschwester Iris kennen zu lernen. Die beiden beschnuppern sich im ersten Stock des wohlbürgerlichen Backsteinhauses des Vaters, der Dozent am College ist. Iris liegt auf dem Bett, die kleine Eva hockt auf dem Teppich davor und während ihr die andere Tochter des Vaters mit ihren 16 Jahren wahnsinnig erwachsen und elegant vorkommt, fährt unten die Mutter weg, nicht ohne einen braunen Tweedkoffer für Eva dazu lassen. Dass ihre Mutter sie verlassen hat, begreift Eva erst ein Jahr später. Ein Jahr, in dem Iris ihre große Schwester wird. Sie hilft der Kleinen in der Highschool zurecht zu kommen, die sie dafür bedingungslos dabei unterstützt eine lokale Berühmtheit zu werden. Für Iris‘ Auftritte als Rednerin in der Schul-Aula, bei örtlichen Rotary Clubs und Veteranentreffen muss Rezitieren geübt werden, Kleider geschneidert und Wangen geschminkt werden.
Genauso bedingungslos wird Eva der großen Schwester später nach Hollywood folgen, noch später nach New York. Die beiden werden Gus kennen lernen. Iris wird doch keine berühmte Schauspielerin werden, aber es wird gehen mit dem Leben und dem Glück. Gut genug jedenfalls.
So wie es im echten Leben auch meistens gut genug ist. Meistens ohne Tusch und erste Szene, was daran liegen könnte, dass keiner weiß, was genau der Anfang sein soll. Irgendwas war ja immer schon vorher. Etwas, mit dem wir klar kommen und umgehen müssen. Oder wie Amy Bloom es ausdrückt: Die Drehungen und Wendungen in Evas, Gus‘ und Iris‘ Leben haben alle mehr damit zu tun, wie Menschen auf das Schicksal Leben reagieren.
Amy Bloom sagt, sie habe eigentlich nur vier Themen: Liebe, Sex, Tod und Familie. Damit müssen ihre Protagonisten in „Lucky us“ klar kommen. Der zweite Weltkrieg spielt im Amerika der 40er Jahre die Hintergrundmusik, im Vordergrund ist es eine Zeit der Veränderung und der Möglichkeiten für Frauen, für farbige Amerikaner, für viele. So wie Frau Bloom davon erzählt, nutzen Eva, Iris, Gus und all die anderen ihre Möglichkeiten mit wechselndem Erfolg. Manche der biographischen Neu-Erfindungen erscheint mir ein bisschen waghalsiger und kompromissloser als die Lebensläufe von Leuten, die ich so kenne. Etwa wie sich Eva von der Tochter einer alleinerziehenden Mutter zur kleinen Schwester eines Hollywood-Starletts, zur Kartenleserin, Mutter und Ehefrau in New York entwickelt. Dann denke ich, ach, was weiß ich denn ich. Die Irrungen und Wirrungen unseres Lebens verlaufen ja auch nicht nach Drehbuch. Und so manche kaufmännische Angestellte wandert irgendwann nach Mallorca aus um dort ein Café zu eröffnen und wenn das gescheitert ist, kehrt sie vielleicht zurück und eröffnet ein Nagelstudio. Brauche ich eigentlich bloß eine dieser Auswanderer-Sendungen im Privatfernsehen gucken. Amy Bloom jedenfalls findet keine ihrer Figuren besonders außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist höchstens die Unaufgeregtheit, mit der sie mich mit ins Amerika der 40er Jahre nimmt. Die Details sitzen, nein: sie sind einfach da, nie fühlt es sich an, als gebe mir gerade jemand eine Geschichtsstunde. Es ist einfach Evas Gegenwart und über die denkt ja auch niemand mit besonderer Melancholie nach.
Seit ich den wirklich großartigen Roman der Amerikanerin Amy Bloom gelesen habe, denke ich wieder stärker darüber nach, was ich bestimmen kann, was mich bestimmt und was ich am Ende damit mache. Amy meint: „In Erzählungen wie im echten Leben ist es nicht so sehr das Schicksal, das uns formt, sondern wie wir darauf reagieren.“ Vielleicht hat sie mit dem, was sie mir letztes Jahr in einem Interview anlässlich der deutschen Veröffentlichung von „Wir Glücklichen“ erzählt hat ja recht.
Wenn ich diesen anderen ersten Satz aus Die unglaubliche Reise der Lilian Leyb von ihr lese, bin ich geneigt das zu glauben: „Es ist immer das Gleiche: Die besten Feste werden von Leuten mit Sorgen gefeiert.“
Im Oktober erscheinen Kurzgeschichten von Amy Bloom.
* Erste Sätze können eben auch toll sein. Trotzdem geht es auch ohne, scheint mir. Natürlich nicht ohne ersten Satz, aber ohne super-tollen ersten Satz.